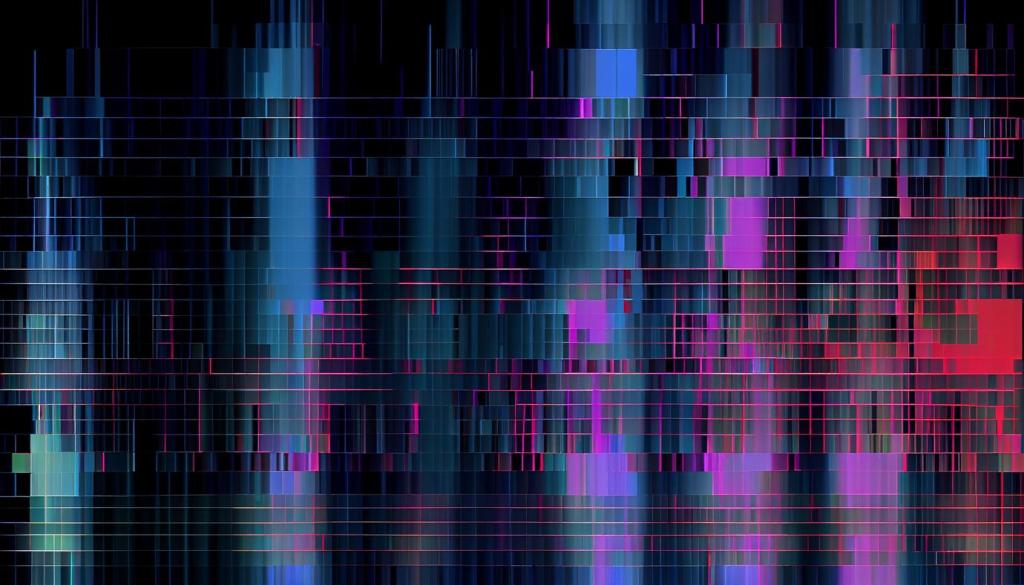Generalisierung sichern: Reguläre Werkzeuge gegen Überanpassung
Wenn Trainingsfehler sinkt, Validierungsfehler aber steigt, schlägt Überanpassung zu. Lernkurven, Frühstopp-Kriterien und einfache Baselines helfen, rechtzeitig gegenzusteuern. Halte Datensplits sauber, dokumentiere Metriken konsistent und prüfe regelmäßig, ob das Modell wirklich verallgemeinert.
Generalisierung sichern: Reguläre Werkzeuge gegen Überanpassung
L2-Gewichtszerfall zügelt Parameter, Dropout verhindert Ko-Abhängigkeiten, frühzeitiges Stoppen spart Ressourcen. Datenvergrößerung stärkt Robustheit, auch bei tabellarischen Aufgaben durch realistische Rauschmodelle. Teile, welche Kombination aus Methoden deine Modelle zuverlässiger gemacht hat.